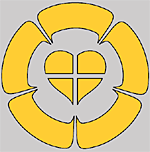
Druckversion der Seite: Newsdetail
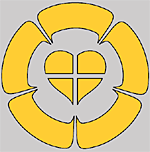 |
Martin-Luther-Bund Druckversion der Seite: Newsdetail |
Aktuelle Meldung14.04.2014 - Kategorie: Ungarn, LD online
LD online: Christentum und PolitikBischof Tamás Fabiny über Gefahren des politischen Christentums
Auszug aus dem »Lutherischen Dienst« 1/2014 Sie sind ein Fan der Fußballmannschaft »Fradi«. Zumindest waren Sie das in Ihrer Kindheit. Besuchen Sie noch Fußballspiele? Sehr selten. Als Fradi allerdings aus der 1. Liga abgestiegen ist, bin ich demonstrativ zu den Fußballspielen gegangen. Ich hielt es für eine Ehrensache. In der Zeitschrift »Evangelisches Leben« schrieb ich einen Artikel über die Kunst des »Verlierens«. Man muss nicht immer gewinnen. Auch aus einer Niederlage kann man etwas lernen.
Bezogen auf Ungarns Fußball heute, ist dieser Artikel immer noch aktuell. Was halten Sie von den immer neuen Stadionbauten? Beispielsweise wird in dem kleinen Dorf Felcsút (Heimatgemeinde von Premierminister Viktor Orbán) gerade eine Arena für 3500 Zuschauer gebaut. Das überraschte mich. Ich kann verstehen, dass der Ministerpräsident Fußball mag, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er beweisen will, dass auch eine kleine Ortschaft große Träume haben darf. Jedoch las ich vor kurzem, dass gerade einmal 100 Zuschauer das Ligaspiel der Felcsuti-Puskás-Akademie interessierte. Es ist eine gute Sache, wenn im Land Fußballakademien gegründet werden. Bei Prestigebauten wäre es geschickter, Mäßigkeit zu üben.
Zur Zeit der sozialistischen Regierung Anfang 2010 sagten Sie, dass Sie es kaum erwarten können, Kritiker einer konservativen Regierung zu werden. Damit formulierten Sie nicht nur den Wunsch nach einem Regierungswechsel, sondern behielten sich auch das Recht für Kritik vor. Im letzten Frühling machten Sie bereits auf die Gefahren der Verwendung von christlichen Sinnbildern in der Politik aufmerksam. Die Konferenz wurde von jungen Christdemokraten organisiert. Ich hatte den Eindruck, dass sie von mir nicht diese Worte erwartet hatten. Macht aber nichts. Wenn ich immer das sagen würde, was erwartet wird, würde das, was ich sage, an Gewicht verlieren. Das Christentum wird politisiert, wenn die politische Macht auf paternalistische, bevormundende Weise auf die Kirche setzt. Wenn sie die Kirche als Mittel zum Zweck benutzen möchte, um eigene Ziele zu verwirklichen. Von keiner Partei, noch nicht einmal von einem Bürgermeister, kann ich akzeptieren, dass wir als selbstverständliche Verbündete betrachtet werden und dadurch ein Anspruch auf die politische Unterstützung der Kirche erhoben wird. Wir müssen alle gemeinsam an der Erstellung einer gemeinsamen Werteordnung arbeiten, aber dadurch sind wir nicht automatisch die Verbündeten von jemandem. Zur Zeit der Diktatur wurde versucht, die Kirche so stark zu unterdrücken, dass sie die herrschende Macht ohne Kritik unterstützt. Zum Glück gab es auch damals Menschen, die dem entgegengetreten sind. Man darf nicht vergessen, dass in der Zeit, als die derzeitige Opposition regierte, gegenüber der Kirche viele Erniedrigungen und unverdiente Ausgrenzungen stattgefunden haben. Auf der anderen Seite ist es auch zweifelsohne so, dass Kirchen immer wieder versuchen, mit der politischen Macht zu kokettieren. Klar ist auch: Gäbe es ein normales Finanzierungssystem in Ungarn, wären die Kirchen nicht gezwungen, ständig über finanzielle Belange mit der Regierung zu diskutieren. Hier denke ich an ein berechenbares und transparentes Finanzierungssystem, das auch dann bestehen bleibt, wenn es einen Regierungswechsel gibt. Das sollte keines sein, das – wie einige meinen – von den Gläubigen allein gestemmt werden sollte. Das ist großer Unsinn. Gerade als ob jemand sagen würde, dass die Operngänger die Ungarische Staatsoper finanzieren sollten. Kirchen übernehmen nicht nur Aufgaben im Bereich Erziehung und Soziales, sondern ihre seelsorgerliche Arbeit hat heilenden Einfluss auf die ganze Gesellschaft.
In welchem Maße werden christliche Werte von Parteien zur Politisierung benutzt? Bis zu einem gewissen Grad ist das in jeder Partei gegeben, doch am meisten bei der Jobbik. (Jobbik ist eine rechtsradikale Partei. Das Wort »jobbik« hat die Bedeutungen »besser, rechter«. Offizieller Parteiname ist: Bewegung für ein besseres Ungarn.) Ich sehe mich gezwungen, den Wort- und Sinngebrauch sowie die Tatsache, dass Jobbik das wichtigste christliche Symbol, das Kreuz, für politische Ziele benutzt, ganz kategorisch als Blasphemie zu werten. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich auch über das Kreuz im Parteilogo der Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP) nicht glücklich bin. Desgleichen höre ich es auch nicht gerne, wenn Ministerpräsident Viktor Orbán hin und wieder seine Reden mit den Worten »Liebe Gemeinde« beginnt und mit den Worten »Soli Deo Gloria« (»Allein Gott die Ehre«) beendet. Ich freue mich, wenn er dies als Privatperson so denkt, aber dies sollte nicht der Redestil der Regierung sein. Die nicht mehr existierende Partei Bund Freier Demokraten (SZDSZ) hatte einen berühmt-berüchtigt gewordenen Wahlspruch: »Mein Reich komme!« Nur geringes Gehör fand jedoch, dass ich 1990 bei der ersten freien Parteiwahl Einwand gegen ein Plakat der MDF (Ungarisches Demokratisches Forum, Regierungspartei 1990–1994) erhoben hatte. Auf dem Plakat stand »Dein Reich komme!« Die MDF hat meiner Meinung nach hier eine größere Blasphemie begangen. Die SZDSZ hat wenigstens selbst entlarvt, welch egozentrischen Standpunkt sie als Partei vertritt. Die MDF hat hingegen ein Wort der Bibel komplett übernommen: Sie haben Ungarn mit dem Reich Gottes verwechselt. So weit zum Thema Parteien.
Kürzlich ist von Ihnen ein Buch mit Radioandachten zu aktuellen Themen erschienen. Bei der Buchvorstellung sagten Sie, bevor Sie aus dem Buch mit dem Titel »Der obdachlose Jesus« vorlasen, dass Sie die derzeitigen Maßnahmen gegenüber den Obdachlosen als »schmerzlich und ungerecht« empfinden. Nur kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Kirchen dagegen Protest erhoben hätten. Wir sind nicht scheinheilig: Natürlich weiß jeder, dass dieses Thema ein außerordentlich schweres ist. Niemand freut sich darüber – auch ich nicht –, wenn er jeden Tag aufs Neue damit konfrontiert wird, dass vor seiner Haustür schon wieder uriniert wurde. Trotzdem versuchen wir zu helfen. Mit meiner Familie zum Beispiel bringen wir den Bedürftigen im Haltestellenhäuschen warme Decken und Lebensmittel. Wir verfassen gerade eine evangelisch-lutherische Stellungnahme, in der wir ausführen, dass es auf keinen Fall eine Lösung sein kann, den Obdachlosen den Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen zu verbieten (die Stadtverwaltung von Budapest erließ nach Abstimmung am 13. 11. 2013 eine Anordnung, dass es Obdachlosen verboten ist, sich an bestimmten öffentlichen Plätzen aufzuhalten), sondern der Ausbau eines Organisationsnetzes von Nöten ist. Solange der erforderliche finanzielle und infrastrukturelle Hintergrund nicht gesichert ist, sagt der Oberbürgermeister oder wer auch immer ganz umsonst, dass es attraktive Obdachlosenunterkünfte in Budapest gibt. Es gibt sie nicht. Es ist nicht recht, es ist sogar – schärfer gesagt – eine Sünde, die Obdachlosen als kriminell abzustempeln, vor allem noch bevor wir angemessene Voraussetzungen für sie geschaffen haben. Ihre Frage hat sich natürlich darauf bezogen, warum wir nicht lauter protestiert haben. In einigen Interviews haben sowohl ich als auch meine Mitarbeiter, die sich mit der Obdachlosenproblematik alltäglich auseinandersetzen, unsere Meinung kundgetan. Stolz bin ich auf unsere Pfarrerin Márta Románné Bolba, die auf einigen Demonstrationen das Wort ergriffen hat. Zusammen mit den Mitgliedern der Gruppe »Die Stadt gehört allen« und Obdachlosen nahm sie an Sitzungen der städtischen Verwaltung teil. Von ihrer Seite aus hat sie alles getan. Ich halte es für wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass Pfarrerin Bolba nicht unter der Kategorie »geduldet« in unserer Kirche fällt. Ganz im Gegenteil: Sie erfährt die maximale Unterstützung der Kirchenleitung. Wenn es doch mehr Menschen wie sie gäbe! Im Advent müssen wir diese von der Kirche geleisteten Aktivitäten betonen. Dies sind nicht nur karitative Taten, sondern sie stellen gleichsam auch ein Bekenntnis für Jesus dar, dessen Geburt davon handelt, dass Gott sich erniedrigt hat und ganz tief herabgekommen ist. Ich wünsche mir, dass in dieser gleichgültigen Gesellschaft mehr Menschen diese radikale theologische Botschaft hören würden.
In Ihrem Buch heißt ein Kapitel »Von der kranken Kirche«. Was fehlt der Kirche und wie krank ist sie? An sich ist es schon eine Krankheit, dass wir durch Spaltungen getrennt sind, obwohl Gott uns doch als Einheit geschaffen hat. Es gibt viele Krankheitssymptome. Oft ist die Kirche wie gelähmt: Sie bewegt sich schwerfällig, reagiert langsam. Mit Papst Franziskus ändert sich schon etwas in der großen römisch-katholischen Kirche. Ein Krankheitssymptom ist auch die Unbescheidenheit, die sich darin ausdrückt, dass die Kirche meint, für alles eine Lösung zu kennen. Luther unterscheidet zwischen der Theologie der Herrlichkeit und der Theologie des Kreuzes. In kleineren neoprotestantischen Gemeinden macht sich die Auffassung breit, dass Erfolg ein Segen Gottes ist: Am Maß des Erfolges sei die Gotteszugehörigkeit messbar. Zu diesem Zweck wird sich an politische Macht geschmiegt, denn schließlich ist die Kirche auf der Seite der Herrlichkeit. Im Gegensatz dazu lehrt Luther, dass die Kirche neben den Leidenden, den an die Peripherie Gedrängten, den Ausgeschlossenen und den Erniedrigten stehen muss. Die Kirche ist auch in der Hinsicht krank, dass sie einige unbewältigte Themen mit sich herumträgt, wie etwa das Thema der Informanten.
Die Lutheraner waren den römischen Katholiken und den Reformierten weit voraus, was die Intensität der Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit betrifft. Dann ist die Aufbereitung irgendwie ins Stocken geraten. Sie ist ganz und gar nicht ins Stocken geraten. Es gab nach außen hin eine scheinbare Pause von zwei Jahren, aber im Hintergrund wurde richtig viel Zeit und Energie in die Feinarbeit investiert. Nach Beschluss der Lutherischen Synode muss als Erstes die Vergangenheit der Kirchenleitung offengelegt werden. Innerhalb der nächsten Wochen wird ein dicker Band erscheinen, in dem das Leben von zwei lutherischen Bischöfen, Zoltán Káldy (Bischof des südlichen Kirchenbezirks der ELKU zwischen 1958 und 1987) und Ernő Ottlyk (Bischof des nördlichen Kirchenbezirks der ELKU zwischen 1967 und 1982), ausführlich dokumentiert wird.
Waren beide Informanten? Ja, aber das Spannende daran ist, dass beide Personen nebeneinander beschrieben werden, es sich jedoch dabei herausstellt, dass es riesengroße Unterschiede von Informant zu Informant gibt. Sie haben von ein und derselben Veranstaltung ganz verschieden berichtet: Zoltán Káldy berichtete unter dem Decknamen »Pécsi«, Ernő Ottlyk hatte den Decknamen »Szamosi«. Ich möchte aber vor der Veröffentlichung keine weiteren Details verraten. Moralisch möchte ich keinen von ihnen freisprechen. Tatsache ist jedoch, dass Zoltán Káldy seine eigenen kirchlichen Vorstellungen verwirklichen wollte, der Preis dafür war seine Unterschrift als Informant. Ernő Ottlyk jedoch hat auf einer wesentlich abstoßenderen Art anderen geschadet, um seinen eigenen Vorteil zu suchen. Persönlich bin ich insofern involviert, als Zoltán Káldy mich zum Pfarrer ordiniert hat. 1983, kurz bevor ich mich auf eine Reise nach Kanada begab, wollte man mich »rekrutieren«. In meinem aufgewühlten Gemütszustand rief ich meinen Vater an und wandte mich an Bischof Káldy. Zu meiner größten Überraschung und Freude erachtete er es als selbstverständlich, dass ich nicht kooperiere. Wenn sie mich erneut fragen, solle ich sagen, dass ich nicht mit ihnen zusammenarbeiten will, und dies auch von Zoltán Káldy ausrichten. Genau dies habe ich getan. Sie kamen fortan nicht mehr zu mir, und es gab auch keine Vergeltung.
Kürzlich hielt ein Professor einen Vortrag über den Antisemitismus von Luther, und zwar auf einer Veranstaltung der Lutheraner. Wie kann aufgearbeitet werden, dass der Begründer des Luthertums ein Antisemit war? Es fühlt sich nicht gut an, dem ins Gesicht zu sehen, aber noch schlimmer wäre es, dies zu verschweigen. Man muss ehrlich reden.
Erschüttert dies nicht den Glauben? Nein. Denn ich glaube ja nicht an Luther, sondern an Gott. Andererseits kann ich – wenn auch nicht in diesem Punkt, aber in zahlreichen anderen – seiner Lehre folgen. Endre Bajcsy-Zsilinszky (ursprünglich rechter, ungarischer Politiker und Journalist, der jedoch in der Zeit der Nazibesatzung Ungarns seine Waffe gegen die Gestapo erhob; im Dezember 1944 wurde er exekutiert), der auch Lutheraner war, vertrat ebenfalls in einem Lebensabschnitt antisemitische Ansichten. Zugegeben, da gibt es einen großen Unterschied, denn er war in jungen Jahren Rassist und wurde später Widerständler. Bei Luther war das leider genau umgekehrt. Jemand sagte einmal, dass es für den guten Luther besser gewesen wäre, wenn der Herr ihn drei Jahre früher zu sich berufen hätte. Denn in seinen letzten drei Lebensjahren gibt es diese antisemitischen Züge bei Luther, die sich nicht auf sein ganzes Leben ausgewirkt haben. Trotzdem sind das absolut unakzeptable Aussagen von ihm.
Es waren nicht seine eigenen Gedanken, denn die meisten übernahm er von früheren antisemitischen Schreibern. Der Kontext im 16. Jahrhundert war vollkommen anders als heute, trotzdem darf so etwas zu keiner Zeit niedergeschrieben werden, dass Juden anzuzünden sind. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass Luther in seinen früheren Werken positiv über die Juden gesprochen hat. Sein späterer Antisemitismus wirft einen Schatten auf sein Werk, jedoch verdunkelt es sein Lebenswerk nicht gänzlich. Seine unerhörten Aussagen können von der evangelisch-lutherischen Kirche höchstens zur Abschreckung zitiert werden. In unserer Kirche war das Jahr 2013 das »Jahr der Toleranz«. Wir haben Ausstellungen, Konferenzen und Kulturveranstaltungen organisiert. Eine Konferenz für lutherische Schulleiter und Lehrer wurde einberufen, in der wir ganz eindeutig zum Ausdruck brachten, dass in lutherischen Schulen Schimpfworte über Roma, Schwule oder Juden unter keinen Umständen geduldet werden dürfen. In unserer Kirche gibt es ganz einfach keinen Platz für Erscheinungsformen des Extremismus.
Tamás Fabiny wurde 1959 in Budapest geboren. 1982 wurde er zum Pfarrer ordiniert. Er studierte in Erlangen und in Chicago. Neben seinem Pfarrdienst arbeitete er bei dem Fernsehsender Duna TV. 2005 wurde er in das Bischofsamt des nördlichen Kirchenbezirks der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Ungarn eingeführt. Seit 2010 ist er Ratsmitglied und Vizepräsident im Lutherischen Weltbund. Sein neuestes Buch, in dem eine Auswahl von Radioandachten zu lesen und zu hören sind, ist unter dem Titel »Kereszt fogantyú nélkül« (»Kreuz ohne Handgriff«) im Luther Kiadó Verlag 2013 erschienen. Das Interview erschien in der Wochenzeitung Népszabadság in der Ausgabe vom 12. 12. 2013. Die Fragen stellte Gábor Czene.
Auszug aus dem »Lutherischen Dienst« 1/2014. Wenn Sie die weiteren Artikel lesen möchten – etwa ein Bericht über die evangelisch-lutherische Gemeinde in Odessa, über Armutsmigration in Europa, über die Identität der lutherischen Diasporakirchen aus britischer Sicht oder über die Aktivitäten der Gemeinden in Wolkendorf/Rumänien und Jarowlawl/Russland –, bestellen Sie den » Lutherischen Dienst kostenlos.
|